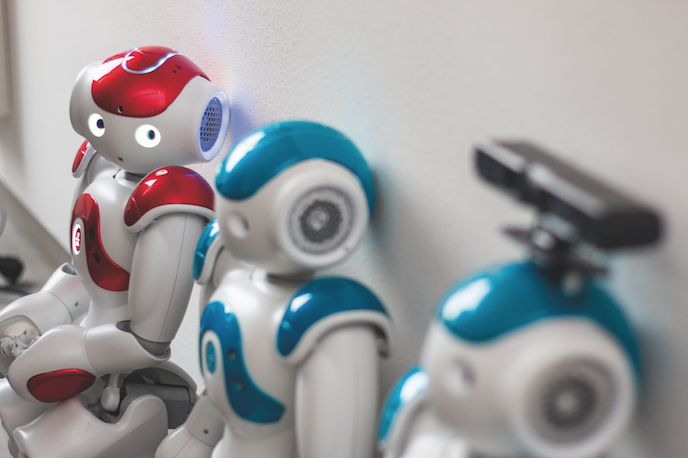AKUT-GESPRÄCH Der Entwicklungsbiologe Prof. Dr. Michael Hoch ist der Rektor der Universität Bonn. Im AKUT-Gespräch erklärt er, wie er die Last von Sparmaßnahmen positiv nutzen möchte und wie viel Einfluss er auf das Sprachkursangebot und auf den Anteil an Professorinnen hat.
INTERVIEW ALEXANDER GRANTL & SVEN ZEMANEK

Strahlt mit der Sonne um die Wette: Prof. Dr. Michael Hoch (Foto: Alexander Grantl / AKUT)
AKUT Sie sind nun seit Mai Rektor der Universität Bonn. Wie hat sich seitdem Ihr Kontakt zu den Studierenden verändert?
HOCH Ich habe andere Gruppen von Studierenden kennengelernt. Früher hatte ich schon ein ganz intensives Verhältnis zu unseren Studierenden im Fachbereich molekulare Biomedizin, aber durch meine neue Tätigkeit habe ich viel mehr Termine mit verschiedenen Studierenden. Zum Beispiel habe ich den AStA besucht – zu dem hatte ich früher gar keinen Kontakt. Und ich war bei den Fachschaften – und habe dort auch gehört, mit welchen Fragen man sich dort beschäftigt. Ich denke, dass ich da einen ganz guten Kontakt habe.
AKUT Sie haben auch viele neue Aufgaben bekommen. Gibt es etwas, das Sie besonders gerne machen? Etwas, das Sie gar nicht gerne machen?
HOCH Den Kontakt zu den verschiedenen Gruppen zu pflegen, mache ich besonders gerne. Die Studierenden haben Sie schon angesprochen: Es macht mir große Freude, mit ihnen zu sprechen und zu hören, was sie so bewegt. Aber auch der Kontakt zu den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ist mir natürlich besonders wichtig. Auch jetzt, wo wir vor einer neuen Runde der Exzellenzinitiative stehen und dazu viele Gespräche stattfinden. Das macht große Freude. Außerdem habe ich alle Dezernate in der Verwaltung besucht und mich mit den Mitarbeitern dort intensiv ausgetauscht. Wir treffen uns nun regelmäßig mit den Dezernaten, um uns informell auszutauschen. Was mir auch große Freude macht, ist der Außenkontakt. Unter anderem habe ich den neuen Oberbürgermeister Bonns besucht und auch den Landrat des Rhein-Sieg-Kreises. Zudem habe ich mich mit verschiedenen Gruppen aus der Stadtgesellschaft unterhalten, um die Uni auch dort noch präsenter zu machen. Das ist zurzeit sehr wichtig.
AKUT Was macht nicht so viel Spaß?
HOCH Ich kann – ganz ehrlich – eigentlich gar nichts identifizieren, was mir keinen Spaß machen würde. Natürlich gibt es auch Problemsituationen, die man bewältigen muss. Daran hat man nicht unbedingt Spaß, aber das sind Sachen, die man im Alltag eben abarbeiten muss. Wenn es um Personen geht, versuche ich etwa herauszufinden, wie ich die Beteiligten so motiviere, dass das Problem irgendwo gelöst werden kann. Und das ist auch gleichzeitig wieder eine positive Herausforderung.
AKUT Stichwort Herausforderung: Sparen und andere zum Sparen anhalten – erlebt die Universität ihre 200-Jahr-Feier 2018 noch?
HOCH (lacht) Ich hoffe schon! Sparen ist natürlich eine der unangenehmsten Thematiken. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir heute in Zeiten leben, in denen wir uns Gedanken machen sollten, wie wir überhaupt mit Überflusssituationen umgehen. Das ist auch eine Frage an die Gesellschaft. Etwa anhand der Flüchtlingsthematik: Wir sollten uns in einem ganz anderen Kontext Gedanken machen, wie gut es uns geht – besonders im Vergleich zu denen, die ihre Heimat verloren und Gewalt und Tod erlebt haben. Aber zurück zur Universität: Natürlich macht Sparen keinen Spaß. Der entscheidende Punkt ist, wie wir uns mithilfe dieser Sparmaßnahmen neu aufstellen können, ja vielleicht befreien können von Zwängen. Das ist hier die positive Herausforderung: Wie kann ich die Situation so organisieren, dass Forschung und Lehre erhalten bleiben und gleichzeitig eine neue Perspektive daraus resultiert? Das ist eine schwierige Aufgabe, aber es macht Freude, sich auch darüber Gedanken zu machen.
AKUT Haben Sie ein konkretes Beispiel, wie Sie etwa Institute dabei unterstützen?
HOCH Das Thema Energie, zum Beispiel. Da haben wir momentan noch viel Glück, weil die Energiekosten nicht besonders hoch sind. Aber sie werden womöglich steigen. Und wir geben schon jetzt viel Geld für Energie aus, also für Heizung, Strom und Kühlung. 17 Millionen Euro im Jahr. Da stellt sich die Frage, ob wir irgendwo sparen können. Hier in der Verwaltung gibt es da schon gute Konzepte, die ich noch ein wenig weitertreiben möchte. Wir überlegen, wie wir die Institute, in denen aus wissenschaftlichen Gründen viel Energie verbraucht wird, dazu bekommen, kreativ über das Energiesparen nachzudenken.
AKUT »Kreativ nachdenken« klingt noch sehr vage…
HOCH Ich kann das mal konkretisieren: Wenn ein Institut eine Idee hat, wie es Energie sparen kann, sollte ein Teil genau dieser Einsparung wieder an das Institut zurückkommen. Sodass man letztlich ein positives Anreizmodell hätte, das Institute zum Sparen anhalten könnte. Man müsste natürlich überlegen, wie viel der Einsparungen wieder an das Institut zurückgingen, aber man hätte dann vielleicht eine Triebkraft, nochmal ganz anders über das Thema Energiesparen nachzudenken.

(Foto: Alexander Grantl / AKUT)
AKUT Etwas anderes: Im Januar wird ein neues Studierendenparlament gewählt, es gibt auch zwei Urabstimmungen. Wie genau verfolgen Sie solche Entwicklungen?
HOCH Ich verfolge die Entwicklungen, indem ich immer mal wieder über anstehende Termine und ähnliches informiert werde. Ich selber habe mir zwar vorgenommen, zu einer Sitzung des Studierendenparlaments zu kommen, habe es aber bisher noch nicht geschafft. Das nehme ich mir aber für 2016 vor. Bisher habe ich mich, wie gesagt, schon mehrmals mit dem AStA und den Fachschaften getroffen, aber bis zum Studierendenparlament habe ich es noch nicht geschafft.
AKUT Im Senat hingegen waren Sie schon. Der hat neulich eine neue Grundordnung beschlossen – finden Sie die Gruppenparität im Senat nun gut umgesetzt?
HOCH Das ist eine Sache, die nun demokratisch entschieden wurde und ich möchte mich dazu eigentlich gar nicht äußern. Das Verfahren hat auch dazu geführt, dass die Gruppen sehr miteinander gerungen haben. Und dann war es an einen Punkt gekommen, an welchem es eine klare Abstimmung gab. Und die nehme ich nicht nur zur Kenntnis, sondern glaube, dass man hier einen guten Weg für die Zukunft gefunden hat.
AKUT Wünschen Sie sich, das auf andere Gremien – etwa Fakultätsräte – auszuweiten?
HOCH Ich wünsche mir, dass die verschiedenen Gruppen auch weiter an der Fortentwicklung der Universität beteiligt sind. Das ist ein ganz wichtiger Punkt für mich. Auch wichtig ist, dass man ein Gemeinschaftsgefühl entwickelt. Die Gruppen müssen das Gefühl haben, dass sie einbringen können, was ihnen am Herzen liegt. Dass man dabei manchmal nicht seine Maximalposition erreichen kann, muss man akzeptieren. Bisher ist es immer gelungen, im Widerstreit der Ideen und Standpunkte doch Kompromisslösungen zu erzielen, die für alle Seiten positiv waren. Ich bin zuversichtlich, dass man diese Paritätsthematiken unproblematisch wird lösen können. Das ist mein Grundvertrauen, auch in die Kolleginnen und Kollegen, die Studierenden und die Mitarbeiter der Gremien.
AKUT Seit kurzem wissen Sie, dass Sie die philologischen Bibliotheken nicht im Viktoriakarree unterbringen können. Was für Alternativen haben Sie nun?
HOCH Nachdem dieser Prozess 2007 initiiert wurde, haben wir nun eine klare Entscheidung. Wir als Rektorat brauchen eine Lösung bis Mitte 2018, weil uns hier Statik und Brandschutz herausfordern. Nun möchten wir zunächst mit den Nutzern sprechen: Wie ist der Bedarf? Muss justiert oder moduliert werden? Es ist ja nun einiges an Zeit vergangen. Und wir müssen mit der ULB sprechen, weil diese auch beteiligt ist. Dazu werden wir gleich 2016 diese Gruppen zusammenrufen, um den Bedarf zu klären und die räumlichen Möglichkeiten zu beurteilen. Erst dann können wir entscheiden, ob es vielleicht einen Umzug oder einen Neubau braucht.
AKUT Kommen wir noch zu den Professorinnen: Schon in Ihrer Antrittsrede hatten Sie angekündigt, dass Sie den Professorinnen-Anteil »signifikant erhöhen« wollten. Der liegt in Bonn unter dem ohnehin niedrigen NRW-Durchschnitt. Wie tun Sie das? Was haben Sie schon getan?
HOCH Da haben wir in den letzten Jahren doch einiges erreicht. Die Anzahl der Professorinnen ist schon deutlich gestiegen. Das ist ganz wesentlich der Aktivität des Gleichstellungsbüros und der Gleichstellungsbeauftragten geschuldet. Als Rektor bin ich auch Vorsitzender der Gleichstellungskommission. Hier versuchen wir zu überlegen, wie wir in Berufungssituationen den Professorinnen-Anteil erhöhen können. Schlussendlich hängt das aber wesentlich von den Fakultäten ab, die unterschiedlich erfolgreich beim Erreichen dieser Ziele sind. Wir im Rektorat versuchen, aktiv Einfluss auf die Fakultäten auszuüben, sodass sie in den Berufungskommissionen dieses Thema im Auge haben.
AKUT Wünschen Sie sich, hier mehr Einfluss haben zu können?
HOCH Hier geht es letztlich darum, ein Vertrauensverhältnis zwischen Rektorat und Dekanen zu erzeugen. Das entwickelt sich in den letzten Monaten sehr positiv. Wir arbeiten sehr gut zusammen und ich bin optimistisch, dass wir über den guten Kontakt zu Dekanen und Fakultäten das Ziel, den Professorinnen-Anteil zu erhöhen, in den nächsten Jahren erreichen werden.
AKUT Mitglieder des AStA werfen Ihnen vor, Sie würden die Universität zu »ökonomisch« sehen. Im AStA-Heftchen »Friedrichs Wilhelm« wurde Ihre Rede zur Eröffnung des akademischen Jahres kritisiert. Etwa, dass Sie vom Wettbewerb der Universitäten gesprochen hätten. Was entgegnen Sie dieser Kritik?
HOCH Ich bin natürlich für Meinungsfreiheit und halte es für absolut legitim, dass jemand eine andere Meinung dazu hat. Allerdings sehe ich die Situation anders. Ich glaube, dass wir als Universitäten natürlich im Wettbewerb stehen – nicht nur um finanzielle Ressourcen, sondern auch um Köpfe und Talente – also Studierende und Wissenschaftler. Wir stehen also in einer Wettbewerbssituation und müssen überlegen, wie wir Schwerpunkte setzen, um erfolgreich zu sein.
AKUT Wie gut steht Bonn in diesem Wettbewerb der Universitäten und Hochschulen denn da?
HOCH Wir stehen sehr gut da. Das sehen wir an einigen Kennzahlen, etwa, dass wir seit Jahren auf Platz 1 sind, was die Förderung der Naturwissenschaften durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft DFG betrifft. Auch bei internationalen Uni-Rankings sind wir sehr gut, in den letzten Jahren häufig unter den ersten 100, mit nur wenigen anderen deutschen Universitäten. Diese Zahlen sind deswegen wichtig, weil Wissenschaftler und Studierende oft anhand dieser Kennzahlen entscheiden, ob sie an die Uni Bonn kommen oder an eine andere Universität gehen. Sie sind sicher auch stolz, einer sehr guten Universität anzugehören. Und das zieht sich weiter in Ihr Leben, später im Beruf und alles, was nach dem Studium kommt. Und es ist doch einfach spannend, wenn man talentierte, kreative Professoren hat und davon lange profitieren kann.
Es ist also ganz wichtig, dass wir im Wettbewerb gut positioniert sind. Doch es ist auch noch Luft nach oben, etwa, weil wir keine Exzellenzuniversität sind, wie Köln und Aachen. Wir haben hervorragende Voraussetzungen, auch diesen Schritt noch zu schaffen. Wir bereiten uns darauf vor.
AKUT Wir haben mal einige Studierende gefragt, welche Fragen sie Ihnen stellen würden. Da kam beispielsweise »Warum schaffen Sie nicht mehr Sprachkurse?« Wie viel Einfluss haben Sie eigentlich auf so etwas?
HOCH Im Alltag nicht besonders viel. Aber wenn ich das zum Thema, zur Aufgabe mache, können wir im Rektorat natürlich schon einiges bewegen. Die Frage, warum es nicht mehr Sprachkurse gibt, ist letztendlich eine Ressourcenfrage. Wir müssen mit unseren Ressourcen ökonomisch umgehen – auch in diesem Bereich. Hier gehen wir schon ans Maximum. Wenn wir dort mehr Sprachkurse schaffen, müssen wir woanders etwas wegnehmen.
AKUT Haben Sie den Eindruck, die Studierenden wissen, was Sie als Rektor tun oder tun können?
HOCH Ich denke, dass viele Studierende das nicht wissen. Aber das halte ich für ganz normal – jeder ist zunächst in seiner eigenen Welt gefangen. Ich kam aus der Welt des Wissenschaftlers im Institut. Nun bin ich hier im Rektorat und habe viele neue Dinge kennengelernt. Wir haben am Anfang ja darüber gesprochen: Kontakt zu allen möglichen Gruppen, Fragestellungen allgemeiner Natur – oft muss man sich da erstmal ein Bild machen. So ist es bei den Studierenden auch, die natürlich primär in ihrer Welt leben. Das ist auch richtig so, denn auch dort muss man sich konzentrieren. Das ist ganz normal, denke ich. ◄