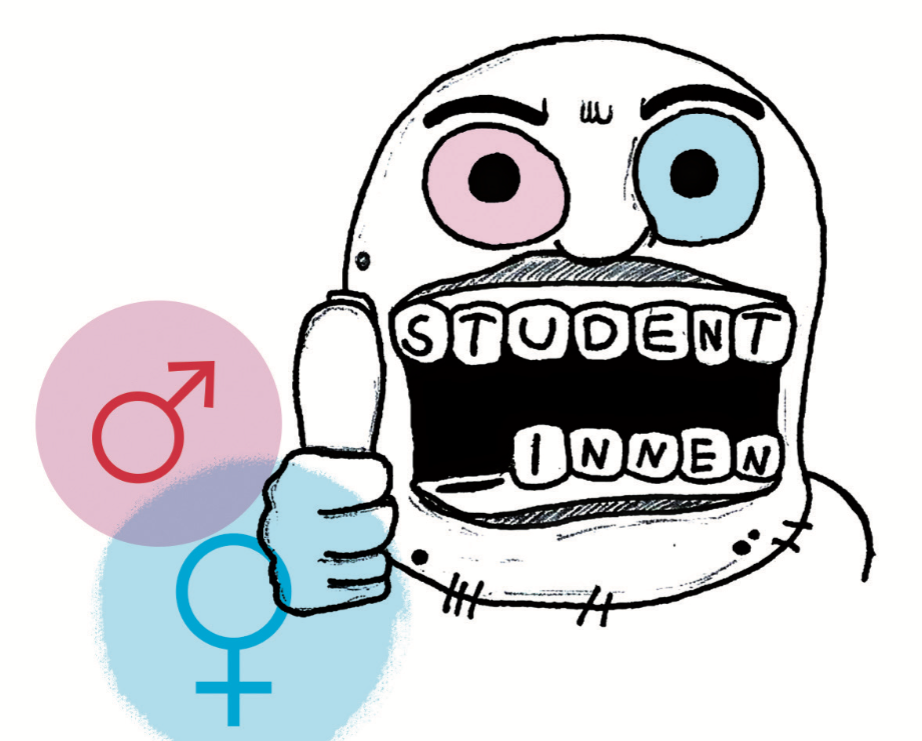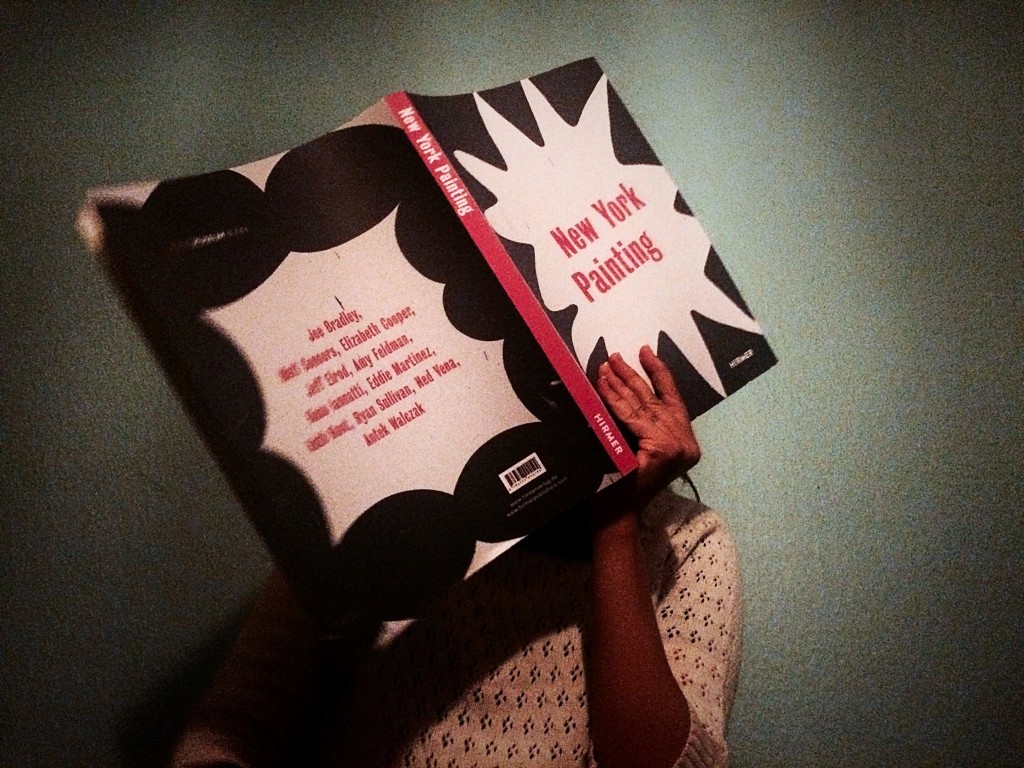RUBRIK: Bonn, deine Lehrenden – Karsten Jung ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Politische Wissenschaft und Soziologie. Im AKUT-Gespräch erklärt er, warum TTIP eine gute Sache, Nordkorea so dunkel und das Auto des US-Präsidenten gar nicht so spannend ist.
Interview Alexander Grantl

Karsten Jung (34): »So wenig, wie die Nordkoreaner über den Rest der Welt wissen, weiß der Rest der Welt über sie« (Foto: Alexander Grantl / AKUT)
AKUT Kannst du nachts gut schlafen? Oder hast du Angst vor TTIP?
JUNG Ich schlafe prächtig – TTIP macht mir wirklich keine Sorgen.
AKUT Warum nicht?
JUNG Nun, grundsätzlich ist TTIP eine gute und richtige Sache. Dabei geht es mir weniger um die konkreten wirtschaftlichen Vorteile als um geopolitisch-strategische Gesichtspunkte: So betrachtet ist es durchaus sinnvoll, dass wir als »westliche Wertegemeinschaft« gewisse Normen und Standards gemeinsam verhandeln. Man darf auch die Alternative nicht aus dem Blick verlieren: Parallel zu TTIP verhandeln die Amerikaner mit den Asiaten – über eine Trans-Pazifische-Partnerschaft. Ob die Standards, die dabei herauskommen, wirklich höher sind als jene, die die EU mit den USA verhandelt, ist sehr fraglich. Und was würde das für den Wirtschaftsstandort Europa bedeuten, wenn ein solches Abkommen die globalen Standards bestimmte? Das halte ich für potenziell problematischer! Klar, in einer idealen Welt würde man bei TTIP natürlich einiges anders machen – aber die Welt ist nunmal nicht ideal – und wie alle Verhandlungen erfordern auch diese Kompromisse.
Das heißt selbstverständlich nicht, dass man die eigenen Werte, Normen und Prinzipien aufgibt. Natürlich: Man muss auch in dieser Situation auf Verbesserungen hinarbeiten! Etwa Druck auf die entsprechenden politischen Verantwortlichen ausüben – denn, dass Schiedsgerichtsverfahren außerhalb des regulären Rechtssystems und unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden, halte ich für falsch. Aber, dass ich diese Kritik teile, heißt nicht, dass ich per se gegen TTIP bin. Wichtig ist, seiner Stimme Gehör zu verschaffen, wie es im Oktober ja auch 150.000 Menschen in Berlin getan haben.
Übrigens: Der VW-Abgas-Skandal zeigt uns ja, dass die europäischen Standards nicht in allen Bereichen die höheren sind. Oftmals haben die USA deutlich höhere Standards, die der Bevölkerung dort auch sehr wichtig sind – die Abgasnorm in Kalifornien, zum Beispiel. Und noch viel wichtiger: Standards im Finanzmarktbereich! Da haben die Amerikaner nach der Finanzkrise viel entschiedener und stärker reguliert als wir in Europa.
Und ob man am Ende des Tages lieber ein amerikanisches Chlor-Hühnchen oder ein europäisches Antibiotika-Hühnchen isst, kann ja jeder für sich selbst entscheiden.
AKUT Schön, dass du das Chlor-Hühnchen selbst nennst. Ärgert es dich, dass in der Diskussion so viel darüber – und über Gen-Mais – gesprochen wird?
JUNG Ja, eindeutig. Wenn sich eine Debatte auf dieser Grundlage abspielt, dann hat jemand das Thema einfach nicht kapiert. Dann versteht man die Tragweite des Ganzen nicht.
Schon klar, solche plakativen Begriffe lassen sich für Demos schön aufs Transparent schreiben. Aber wenn wir auch auf dem Niveau diskutieren, wird das nicht zum Ziel führen. Man muss einfach zur Kenntnis nehmen: Ja, in bestimmten Feldern sind die europäischen Regularien besser und müssen bewahrt werden. Aber: In anderen Bereichen können wir eben auch von US-Regelungen profitieren.
AKUT Neben den Hühnchen stehen derzeit aber auch demokratiegefährdende Inhalte zur Debatte. Was muss passieren, damit die verschwinden?
JUNG Man kann ganz klar erkennen, dass die berechtigte Kritik in der EU mittlerweile angekommen ist. Die EU-Kommission setzt sich inzwischen dafür ein, dass die Schiedsgerichtsverfahren anders gestaltet werden. So entfaltet der öffentliche Druck einen sinnvollen Effekt: Er wird zwar nicht dafür sorgen, dass das Abkommen gar nicht zustande kommt, aber, dass es ein besseres Abkommen wird.
Am Ende muss das Abkommen greifbare wirtschaftliche Vorteile für alle Beteiligten bieten und gleichzeitig demokratischen Standards genügen. Das kann auch so verhandelt werden. Da sind wir jetzt noch nicht, aber wir sind auch noch nicht am Ende der Verhandlungen.
AKUT Vom Freihandel zur Planwirtschaft – 2014 hast du für zwei Wochen eine Reise durch Nordkorea gemacht. Das ist ja eher ein ungewöhnlicher Urlaubsort…
JUNG Tja, ich saß oft hier im Büro, las Meldungen über Nordkorea und dachte: Das kann doch echt nicht sein. Da steht dann, die Männer in Nordkorea müssten jetzt alle die gleiche Frisur wie Diktator Kim Jong-un tragen. Oder, dass das nordkoreanische Staatsfernsehen gemeldet hätte, dass sie die Fußball-WM gewonnen hätten. Oft sind das nur Falschmeldungen in den Medien hier. Aber manchmal kann man sich ja sowas echt vorstellen. Kurz: So wenig, wie die Nordkoreaner über den Rest der Welt wissen, weiß der Rest der Welt über sie. Naja, das – und ’ne Bierlaune mit einer Freundin – war der Anstoß.
AKUT Nach der Reise hast du in Vorträgen über deine Einblicke berichtet und Nordkorea als »dunklen Fleck« bezeichnet – wie ist das gemeint?
JUNG Es gibt diese Nachtaufnahme von Nordkorea aus dem All. Und während in China und Südkorea drumherum alles hell erleuchtet ist, ist Nordkorea ein ziemlich dunkler Fleck. Das stellte sich dann vor Ort, in Pjöngjang zumindest, gar nicht so krass dar. Auch da gibt es Neonlichter.
Dennoch: Die Bezeichnung »dunkler Fleck« trifft in anderen, wesentlicheren Bereichen als der Beleuchtung, zu. Gerade, was Menschenrechte und Grundfreiheiten betrifft. Diesbezüglich ist Nordkorea tatsächlich einer der dunkelsten Flecke der Erde. Auch wirtschaftlich geht’s dem Land natürlich nicht gut, die humanitäre Situation ist dramatisch schlecht – beides resultiert letztlich aus der Politik eines Regimes, das die Menschenwürde seiner Bürger nicht achtet und lediglich am Erhalt der Privilegien einer kleinen Elite interessiert ist.

Jung in der demilitarisierten Zone, die die Koreanische Halbinsel in Nord- und Südkorea aufteilt (Foto: Privat)
AKUT Wird der dunkle Fleck etwas heller, wenn man näher dran ist?
JUNG Heller vielleicht nicht, aber Nordkorea stellt sich doch ein ganzes Stück anders dar, wenn man das vor Ort erleben kann. Zwar nur aus der Perspektive, die man einem Touristen aus dem Westen – natürlich auch ganz bewusst – präsentiert. Aber, dass in der Hauptstadt Handys fast allgegenwärtig und auch chinesische Prada-Kopien zu sehen sind, hätte man so vielleicht nicht unbedingt erwartet. Klar, außerhalb Pjöngjangs sieht das erheblich anders aus. Und dieser Kontrast zwischen der Hauptstadt, die sich mit etlichen Straßensperren vom Land abgrenzt, zum restlichen Nordkorea war auch unerwartet deutlich.
AKUT Was siehst du noch anders, was du vor der Reise nicht erwartet hattest?
JUNG Tja, das ganze bekommt eben ein Gesicht. Im wahrsten Sinne des Wortes: Da lernt man dann seine zwei Reiseleiter kennen, Mr Kim und Mrs Kim – nicht verwandt oder verschwägert. Und Mr Kim war ein spannender Typ! Ende 20, kam gerade von der Universität, wo er Deutsch studiert hatte. Und er sprach ein nahezu perfektes Deutsch, ohne das Land jemals verlassen zu haben. Ein unglaublich aufgeweckter und interessierter Kerl, der mich zum Beispiel detailliert zur Merowingischen Geschichte befragte. Er sprach auch noch fließend Koreanisch, Chinesisch und Englisch. Man hätte ihn am liebsten für ein DAAD-Stipendium vorgeschlagen, doch das geht natürlich nicht. Er konnte auch in den Gesprächen nicht ganz frei sein, hat aber einiges durchblicken lassen. Das hatte wenig mit den Klischees oder Stereotypen über Nordkoreaner zu tun, mit denen man hier immer wieder konfrontiert wird. Nichts von den gleichgeschalteten Massen, die man sonst im Fernsehen sieht. Ein ganz konkretes Individuum – das war sehr spannend.
AKUT Du hast gesagt, man »besichtigt« nicht nur Unfreiheit, sondern man wird auch selbst unfrei. Wieso?
JUNG Ja, das ist definitiv so. Auch, wenn das der Lage natürlich nicht wirklich gerecht wird – die Nordkoreaner haben eine unendlich viel schwerwiegendere Unfreiheit zu ertragen als Touristen, die das Land in einer Art Luxusblase bereisen – und es danach ungehindert wieder verlassen können. Trotzdem: Man bekommt ein Gespür dafür, wie es ist, ohne diese ganzen Selbstverständlichkeiten zu leben. Wir konnten uns da nicht entscheiden, ob wir noch mal eben in die Stadt wollen, ob wir jetzt gerne etwas essen möchten oder nicht. Wenn es Essen gibt, dann wird auch gegessen und alleine in die Stadt zu gehen, ist ohnehin tabu. Man begibt sich in dieses System und liefert sich ihm ein Stück weit aus.
AKUT Von einem sehr unfreien Land zum Land der Freiheit: Du hast ein Jahr an der privaten American University in Washington, D. C. studiert. Was kann eine US-Uni besser als eine deutsche?
JUNG Also ich kann höchstens für meine sprechen: Die war einfach extrem gut vernetzt, mit allem, was es in Washington an Think Tanks und politischen oder Nichtregierungsorganisationen gibt. Dieses Netzwerk war großartig und davon konnte man wirklich profitieren. Da konnte man auch jenseits von allem Akademischen in den Politikbetrieb eintauchen und das sehr »prozesshafte« Wesen des politischen Alltagsgeschäfts mitbekommen. Was ich zudem für eine sehr gute Lebensentscheidung halte: Die Amerikaner machen nach ihrem Bachelor oft was Praktisches. Die gehen für ein oder zwei Jahre arbeiten und kehren erst dann für den Master an die Universität zurück. Das macht die Diskussionen in den Seminaren da ganz anders: Die Leute können alle auf ihre eigenen praktischen Erfahrungen aus völlig verschiedenen Feldern und Ländern zurückgreifen. Das ist echt eine Stärke!
AKUT Und fühlt man sich in Washington näher bei den mächtigsten Menschen der Welt?
JUNG Puuh, klar, manchmal sieht man eine Autokolonne durch die Stadt fahren. Aber das ist dann relativ normal. Da schreit man nicht jedesmal: »Oh, da fährt der Präsident durch die Stadt!!!« Für mich war viel spannender, was so zwei Ebenen darunter, im Hintergrund abläuft: Etwa, wenn sich jeden Mittag irgendwo in ein paar Büros 20 Leute treffen, die dann aktuelle Fragen der Weltpolitik diskutieren. Und das auf einem Niveau, das immens ist. Da kann sich dann jeder dazusetzen und was sagen oder nichts sagen. Aber das zu sehen, wie so maschinenraummäßig Politik gemacht wird, hinter den Kulissen, ist viel eindrucksvoller als so’ne Autokolonne.
AKUT Und zurück in Deutschland hast du dich dann irgendwann entschieden, eine wissenschaftliche Laufbahn einzuschlagen?
JUNG Nö. Endgültig entschieden habe ich mich da noch nicht.
AKUT Du hast zwischendrin ein paar Jahre für die Unternehmensberatung McKinsey & Co. gearbeitet – warum jetzt nicht mehr?
JUNG Für mich gibt’s drei Dimensionen, die so einen Job ausmachen: Die Inhalte, die Prozesse und die Menschen. Letztlich war es die inhaltliche, die den Ausschlag gab: Wie man die Kundschaft für Siemens-Telefone vergrößert ist nichts, was mich morgens wirklich aus dem Bett bringt.
Aber die Prozesse waren spannend. Eine sehr intensive Teamarbeit. Zusammen an Fragestellungen arbeiten, sich sehr konzeptionell Lösungen überlegen, lösungsorientiert arbeiten. Das hat mir gut gefallen. Und die Leute waren auch sehr cool. Man kommt da zu so einer Einführungsveranstaltung – für alle, die nicht BWL studiert haben – irgendwo in Boston. Und dann sitzt man da in einem Firmengebäude – rechts ein Kerl, der gerade seinen Abschluss in Atomphysik gemacht hat, links jemand, der zwei Jahre als Missionar in Haiti gelebt hat. Absolut bemerkenswert. Und jeder hat eine geile Geschichte zu erzählen. Ich finde, was immer man tut, das sollte man mit Leidenschaft und Begeisterung tun. Am besten: Man sollte sich leidenschaftlich für was begeistern.
AKUT Noch ein Wort zum Abschluss, bitte.
JUNG Europa ist eine wichtige Sache. In letzter Zeit ist es an vielen Fronten – Eurokrise, Flüchtlingskrise, und so weiter – vor allem mit Kritik konfrontiert. Wenn wir ein besseres Europa wollen, dann müssen wir auch selbst etwas dafür tun. Deshalb würde ich sagen, auch auf die Gefahr hin, Baumarktwerbung zu zitieren: Mach’ es zu deinem Projekt! ◄