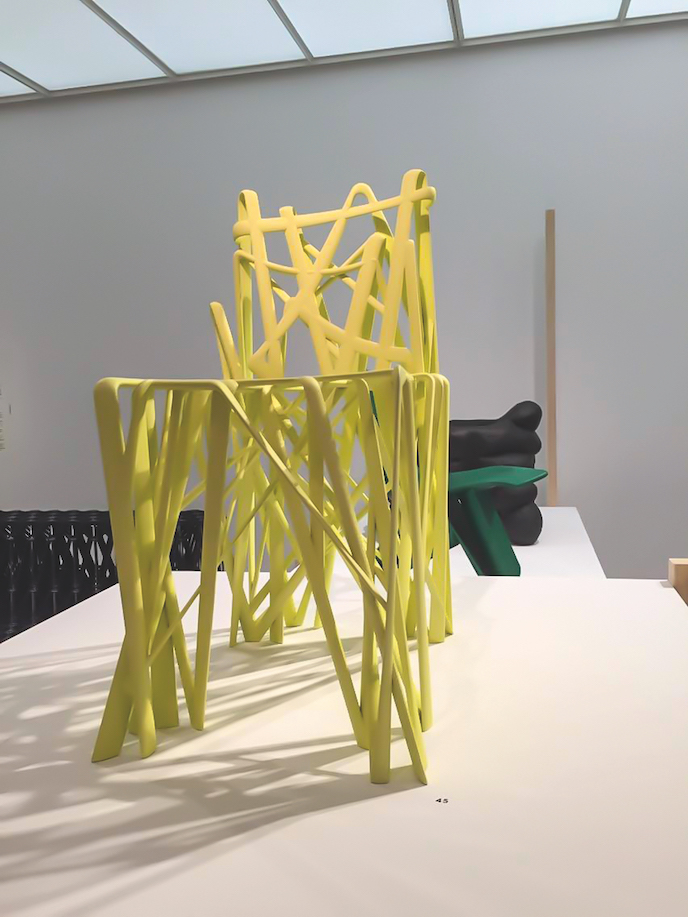HERZLICH WILLKOMMEN Das Wintersemester hat begonnen, das heißt vor allem, dass die Uni wieder jede Menge neue Erstis begrüßt. Du bist neu an der Uni? Dann sind hier zehn (nicht ganz so seriöse) Tipps, die deinen Einstieg in den Uni-Alltag erleichtern könnten.
VON CHARLOTTE KÜMPEL
1. Hol’ dir eine Ersti-Tüte.
Der vermutlich wichtigste Tipp auf dieser Liste. Er gilt übrigens nicht nur für Erstis, sondern für jeden, der auf Gratis-Sachen steht. Jedes Semester aufs Neue werden Ersti-Tüten im Innenhof des Hauptgebäudes sowie im Juridicum verteilt, die meistens zwar zu 80% aus Flyern und Coupons bestehen, aber auch überlebenswichtige Dinge wie pizza.de-Kugelschreiber, Chips oder Energy Drinks enthalten. Um eine der begehrten Tüten zu bekommen, muss man jedoch meistens ganz schön lange anstehen, aber von nix kütt nix!
2. Bei einem leckeren Kölsch lernt man schnell Leute kennen.
Du hast die Ersti-Woche verpasst undkennst noch keine Kommilitonen? Keine Sorge, damit bist du nicht allein. Als Studierender hast du am laufenden Band (alkoholbasierte) Möglichkeiten, neue Leute kennenzulernen. Wenn deine Fachschaft cool ist, bietet sie auch während des Semesters Kneipentouren oder Flunkyballturniere an. Außerdem hat man jedes Semester die Chance, den sogenannten „Kneipenbachelor“ zu machen.
3. Finde dich mit BASIS ab.
Ganz ehrlich, BASIS ist schrecklich. Es gibt keinen Bonner Studierenden, der noch nicht an dem Vorlesungsverzeichnis verzweifelt ist. Grundsätzlich gilt: du bekommst fast nie, was du willst. Das hast du wahrscheinlich bereits bei der Veranstaltungsbelegung für das erste Semester erlebt.
120 Bewerber auf 30 Plätze? Standard. Falls du auch nur einen Kursplatz bekommen hast, den du wirklich haben wolltest, dann kannst du dich bereits ziemlich glücklich schätzen. Manchmal muss man die schlimmen Dinge im Leben einfach akzeptieren!
4. Lass dich auf jeden Fall mal vom Alle-mal-malen-Mann malen.
Alle mal was? Auch wenn dir dieser Mann noch kein Begriff ist, wirst du spätestens nach deinem ersten Abend in einer Bonner Kneipe wissen, wer gemeint ist. Auf den Bildern des Alle-mal-malen-Manns könnte man zwar meinen, dass die gemalten Personen immer eine gewisse Ähnlichkeit zueinander aufweisen, jedoch sollte sich jeder von der lokalen Berühmtheit zumindest einmal porträtieren lassen. Wenn er also auf seinem kleinen Fahrrad angefahren kommt und in die Runde „Alle mal malen, hier?“ fragt, dann sag bloß nicht nein.
5. Es gibt keine Anwesenheitspflicht mehr.
Nutze diese Tatsache, zumindest in deinem ersten Semester. Während man bis vor zwei Jahren nur zweimal pro Kurs im Semester fehlen durfte, reicht es heute schon fast, nur zweimal hinzugehen. Zugegeben, wenn du den Kurs bestehen möchtest, dann reicht das vielleicht nicht. Aber es nimmt dir auch keiner übel, wenn du am morgen nach deiner Fachschaftsparty nicht um 8 Uhr in der Vorlesung sitzt. Lerne, Prioritäten zu setzen!
6. Sag immer ja zu Bonuskarten!
Bonuskarten sind toll. Sie vermitteln dir das Gefühl, dass du als Stammkunde wirklich wichtig bist. Ob Kaffee, Bücher oder Frisörbesuch: beim elften Mal ist’s umsonst! Eine gute Marketingstrategie mit dem Ziel, den Kunden zu halten. Es funktioniert. Studierende lieben Gratis- Sachen! In meinem Portmonnaie befinden sich grundsätzlich mehr Bonuskarten als Geld, und ich freue mich jedes Mal, wenn ich sie einlösen kann. Daher lautet der sechste Tipp dieser Liste: Nimm jede Bonuskarte, die du kriegen kannst!
7. Die ULB ist kein Laufsteg.
Oder doch? Wenn man im Lesesaal sitzt, um für anstehende Klausuren zu lernen oder seine Hausarbeit zu schreiben, könnte man schnell den Eindruck bekommen, dass es sich bei der ULB nicht um eine Bibliothek, sondern um das Casting für die nächste Staffel von Germany’s Next Topmodel handelt. Sehen und gesehen werden ist hier anscheinend für viele das Motto. Andauernd stolzieren balzende Männlein und Weiblein an einem vorbei, eingehüllt in eine Duftwolke, die so enorm ist, dass man sie auf der Zunge schmecken kann. Hohe Schuhe sind hier auch keine Seltenheit, was besonders bei den Personen nervt, die alle zehn Minuten für eine wohlverdiente Kaffeepause rausrennen. Dabei lässt es sich in gemütlichen Klamotten doch viel besser lernen!
Und wenn wir schon dabei sind: Wenn du keinen Laptop dabeihast, dann blockier bitte keine Plätze mit Steckdose!
8. Sei kein Schleimer.
Eigentlich sollte dieser Punkt klar sein, aber es kommt wirklich immer wieder vor. Anders als in der Schule gibt es in der Uni keine Kopfnoten. Am Ende zählt nur deine Prüfungsleistung. Den meisten Dozenten ist es egal, wer du bist, denn für sie bist du nur eine personifizierte Matrikelnummer von vielen. Also vermeide es, in der Vorlesung sinnlose Fragen zu stellen, nur um dem Dozenten zu zeigen, dass es dich gibt. Es sei denn, du möchtest, dass deine Kommilitonen von dir genervt sind.
9. Lade dir nützliche Apps herunter.
Dein bester Freund in langweiligen Pflichtvorlesungen: dein Smartphone. Traurig, aber wahr. Neben den bekannten Apps wie Instagram und Snapchat gibt es jedoch noch weitere Apps, die auf deinem Handy nicht fehlen sollten. Mit der Uni Bonn-App kannst du beispielsweise schon mal den Mensaplan checken um deine Mittagspause zu planen. Dank der Jodel-App weißt du immer, was an der Uni gerade los ist und mit Scanner-Apps kannst du schnell und einfach die Mitschriften deines Kommilitonen in ein PDF umwandeln, falls du in der letzten Vorlesung gefehlt hast (natürlich nur, wenn du vorher gefragt hast).
10. Last but not least:
Lass deinen Abipulli zuhause! Diesen Fehler haben wahrscheinlich schon viele bei der Einschreibung begangen. Abipullis sollten, auch wenn das Abimotto deiner Stufe noch so lustig war und er ja so gemütlich ist, wirklich nur zuhause getragen werden. Wirklich jeder hier hat Abitur, da es nun mal die Voraussetzung für das Studium ist. Den Abipulli zur Vorlesung zu tragen ist also ungefähr so, als würdest du deinen Studentenausweis an einer Kette um den Hals tragen.